|
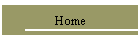
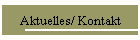
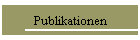
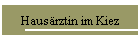
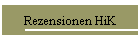
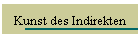
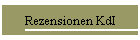
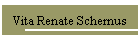


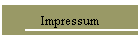
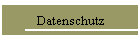
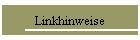
| |
Renate Schernus
Die Kunst des Indirekten
Plädoyer gegen den Machbarkeitswahn in Psychiatrie und
Gesellschaft
Paranus Verlag Neumünster, 253 Seiten, Neumünster 2000, ISBN
3-926200-43-x
Verlagsinformation
Renate Schernus, langjährig leitend in der Psychiatrie von
Bielefeld-Bethel tätig, hat in den vergangenen Jahren vielerorts ihre
Stimme gegen den aufkommenden Machbarkeitswahn in Psychiatrie und
Gesellschaft erhoben und legt hier erstmals die Essenz ihrer
Streitschriften vor – geordnet in drei programmatische Kapitel:
 |
Tatsinn vor Tatkraft – Voraussetzungen klären
|
 |
Zuhören vor Belehren – Selbstwahrnehmung respektieren
|
 |
Umweg vor Zielgenauigkeit – Effektivitätsdogmen hinterfragen.
|
Sie resümiert, konfrontiert, dokumentiert und formuliert, fast
nebenbei und gar nicht resignativ, ethische Leitbilder für den Umgang
mit Menschen, eben »Die Kunst des Indirekten«.

Leseprobe ( 1 )
„Sie (= die sogenannte Bioethik) stellt nicht mehr die eigentliche
Grundfrage aller philosophischen Ethik, nämlich die nach dem guten, nach
dem gelingenden Leben. Sie ermöglicht es, ‚würdelose‘ Fragen zu stellen,
wie z. B. die des Philosophen Murphy: „Gibt es einen Grund, der
unsere Überzeugung rechtfertigen könnte, dass es falsch ist, Behinderte
zu töten und zu essen – gleichgültig welches Ausmaß an Nahrungsknappheit
herrscht?“ (Murphy 1984, in [1])
Um solche Fragen stellen zu können, muss man prinzipiell bereit sein,
bestimmte Menschen von dem, was wir Liebe und Wohlwollen nennen, das
heißt von der Zustimmung zu ihrer Existenz ‚an sich‘, auszuschließen,
denn wenn ich eine solche Frage einem Freund, einem geliebten Menschen
gegenüber stellen würde, zerbräche die Freundschaft an der Frage selbst
und nicht erst an ihrer Beantwortung. Es gibt eine ‚Obszönität‘ des
Fragens, gegen die Pfeifen als Antwort äußerst unschuldig wirkt. Doch
Pfeifen weder im Wald noch im Saal genügt, um der Angst Herr zu werden,
die einen ergreifen kann vor den immer wiederkehrenden
‚Menschheitsbeglückern‘, die Schlimmes verhüten wollen und das
Schlimmste heraufbeschwören werden: Den Verlust der Achtung vor dem
Menschen, wie er ist.“
(S. 66/67)
(...)
„Soweit ich erkennen kann, ist das, was mich in Gesprächen mit
Menschen, die Psychosen durchlebt haben, lenkt, nicht die Erkenntnis
eines Problems und der Glaube, dass ich es lösen könnte. Auch gibt
mir nicht irgendeine psychotherapeutische Schule verlässliche
Sicherheit. Was mich leitet ist schlichter. Um verständlich zu machen,
was ich mit "schlicht" in diesem Zusammenhang meine, muß ich ein
Erlebnis erzählen.
Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn als Psychologin war
Verhaltenstherapie en vogue. Die Kinder- und Jugendpsychiatrische
Abteilung am Max-Planck-Institut, München galt als einsame Spitze auf
diesem Gebiet. Ich wollte dort durch eine Zeit der Hospitation lernen.
Während dieser Zeit wurde mir angetragen, mit einem kleinen Gerät, mit
dem man leichte Elektroschocks austeilen konnte, ein “autistisches”
Kind, welches sich das Einnässen zu Tages- und Nachtzeiten nicht
abgewöhnen konnte (wollte) zu “behandeln”. Eine erfahrene
Krankenschwester auf der dortigen Station lehnte die Beteiligung an
dieser “Therapie” zum Unmut der leitenden Ärzte und Psychologen aus
“gefühlsmäßigen Gründen”, die sie nicht weiter erklären konnte, ab. Ich
nun - damals wunderbar vertraut mit dem ganzen Vokabular und in sich
stringenten Denkmuster des, wie man damals sagte, “Kontingenzmanagements”-
ließ mich mit rationalen Argumenten überzeugen, dass es doch immerhin
besser sei, jetzt dem Kind einige unangenehme “Reize” zuzufügen, als es
seiner steten Nässe, die mit sozialer Ablehnung durch die Mutter, einer
unmöglichen Rolle in der Schule und manchen unangenehmen Folgen mehr
verbunden sein würde. Außerdem konnte ich mich am eigenen Körper
überzeugen, dass der Strom zwar unangenehm, aber nicht unerträglich war.
Dann ging’s los. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass ich zur
Teilnehmerin eines Manövers wurde, das den Charakter des “Auflauerns”
und plötzlichen “Überfallens” hatte.
Unauslöschlich - als Schrecken vor mir selbst - hat sich mir der
Blick des Kindes eingeprägt. Schlagartig wurde mir klar, dass ich die
Beziehung zu dem Kind verletzte, dass ich, egal wer ich für das Kind war
(ich war ihm nicht vertraut), eine Beziehung herstellte, die verletzend,
erschreckend, lieblos “autistisch”, eben nicht bezogen war.
Das kann man zwar, sogar höchst logisch begründet machen, aber was
macht man da?
Die nah mit den Kindern arbeitende Krankenschwester hat sich nicht
verführen lassen. Nur eine idiotische, ehrgeizige, angeblich ganz
rational denkende und diesbezüglich von der Abteilungsleitung gelobte,
junge Psychologin konnte einem “Machbarkeitswahn” dieser Art erliegen.
Dieses Erlebnis hat mich übrigens, so sehr ich mich seiner schäme,
nicht dazu gebracht, jede Methode abzulehnen. Aber mein Empfinden ist:
der Grund, auf dem ich seither stehe, ist der Blick dieses Kindes.
Zur Erholung für Kollegen, die sich nach einer etwas
"wissenschaftlicheren" Ausdrucksweise sehnen, ein Zitat, das, wie mir
scheint, in dieselbe Richtung weist: “So wenig wir auf eine
psychotherapeutische Behandlungstechnik verzichten können, so wichtig
wird hier die korrigierende Einsicht, die uns eine anthropologische
Betrachtungsweise zur Verfügung stellen kann: dass nämlich jede Technik
ihre Möglichkeit und ihre Grenzen an der Struktur einer menschlichen
Beziehung findet.” (16)
Ohne ausreichend tragende menschliche Beziehungen innerhalb und
außerhalb von Psychotherapie helfen einzelne Methoden und Techniken
nichts.“ (S.115 ff)

Leseprobe ( 2 )
Bisweilen werde ich von einem Alptraum heimgesucht: Mein Blick wird auf ein
bedrohliches Bermudadreieck gelenkt, das in seinen Sog zieht, was sich ihm
nähert, und es verschlingt. Über den drei Seiten des Bermudadreiecks stehen
drei Überschriften.
 |
Wir sind die Schöpfer des besseren Lebens und wir bestimmen seinen
Beginn. Ich sehe, wie sich unter dieser Leuchtschrift Gen- und
Reproduktionstechnologen tummeln.
|
 |
Heiliger Hirntod, du erlaubst uns zu handeln. Hier ist viel technisches
Gerät zu sehen. Mit Herzen, Lebern, Nieren wird hantiert. In meinem Alptraum
kann ich nicht erkennen, ob mit Lebenden oder Toten, mit Menschen oder
Tieren umgegangen wird. Alles schiebt sich ineinander.
|
 |
Die dritte Überschrift trägt ein rotes Ausrufezeichen: Das Erlösungswerk
liegt im Erkennen von Wert und Unwert!
|
Ich sehe ein zartes,
verletzliches Gebilde, die Menschenwürde, die in den Sog geraten ist und sich
rasend schnell dem schwarzen Schlund nähert.
Erst am Ende des
Traumes fällt mir die unter Wasser liegende Mechanik auf, die von
Wissenschaftlern und Ökonomen virtuos und in fein abgestimmter Zusammenarbeit
bedient wird. Sie lässt den magischen Strudel entstehen, dem nichts und
niemand widerstehen kann.
Von diesem Alptraum
erwachend, stelle ich mir viele Fragen.

|
|
![]()
![]()