|
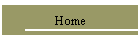
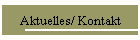
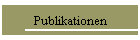
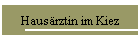
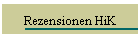
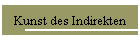
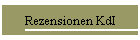
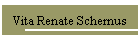


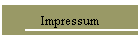
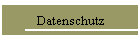
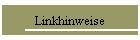
| |
|
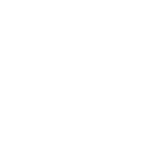
Renate Schernus, Hausärztin im Kiez
Rezensionen von:
 Hartwig Hansen Hartwig Hansen
 Thomas Feld Thomas Feld
 Dr. Gunther Kruse Dr. Gunther Kruse
|
|
Rezension von Hartwig Hansen
Die Lebensbegleiterin
Also, zu diesem Buch gibt es eine
schlechte und eine gute Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören? Ok, die
gute zuerst! Sie lautet: “Ja, es gibt sie noch, die einmaligen Bücher, die,
die es bei 90.000 Neuerscheinungen im Jahr wirklich wert sind, weil sie
nämlich etwas wirklich Neues zum Thema machen.” Dieses Buch sucht
seinesgleichen, es ist ein Original!
Und dabei war eigentlich alles ein
Missverständnis. Im Psychiatrie-Verlags-Beirat tauchte irgendwann die Idee
auf, etwas psychiatrisches Know-how für Allgemeinärzte herauszubringen. Und
Renate Schernus verstand, es solle ein Buch werden unter dem Motto: Was
können wir von den Hausärzten lernen, wie man Psychiatrie auch ganz anders
machen kann?
Sie dachte sofort an ihre Freundin, die
eine hausärztliche Praxis auf unkonventionelle Weise und unter höchstem
persönlichen Einsatz führt und die sie in der Folge zu diesem Buch mehrfach
interviewte.
Herausgekommen ist etwas ebenso
Unkonventionelles: In 27 kurzen Kapiteln gelingt es Renate Schernus durch
die Kunst des Direkten und des Indirekten, den äußerst bunten und mitunter
nervigen Alltag in einer wirklich “gemeindenahen und niedrigschwelligen
Kiezarztpraxis” lebendig werden zu lassen, in die vierteljährlich ca. 1.300
Menschen aus 45 Nationen kommen.
“Ich kann schon an der Art des Ein- und
Ausatmens feststellen, wo die Leute herkommen”, sagt Anna B. “Ich hatte z.B.
mal jemanden aus Grönland, der atmete ganz langsam. Am schnellsten atmen die
Südtürken aus Antalya.”
Anna B. ist Beziehungskünstlerin und
meint an einer anderen Stelle von sich selbst: “Vielleicht bin ich auch
beziehungsgestört.” – weil sich so viele (vor allem substituierte)
Patientinnen und Patienten von ihr abhängig zu machen scheinen.
Sie steht im Zentrum ihrer Praxis und
ihre äußerst pfiffigen und doch so einleuchtenden Ideen im Zentrum des
Buches: Sie “verkuppelt” Menschen, die Hilfe brauchen, und kreiert den
“Beruf” des Situationsbegleiters.
Sie sagt: “Die schwierigsten Patienten
sind die vielen Depressiven. Das hängt eindeutig mit der Arbeitslosigkeit
zusammen. Von den Menschen, die in meine Praxis kommen, haben höchstens noch
30% eine Arbeit oder beziehen Rente. Und mindestens die Hälfte von denen
ohne Arbeit leidet an Depressionen.”
Und sie betreut Drogenpatienten, die
oft lebenslang substituiert werden müssen.
So liegt es nahe, einen von ihnen zu
bitten, zu ihrer Entlastung einmal zu einer alten Frau zu schauen, um der
etwas einzukaufen oder die Medikamente zu holen.
“Und wenn ich einen Drogenabhängigen
habe, der sonst sehr unzuverlässig ist, wird er plötzlich ganz zuverlässig,
wenn da ein Mensch ist, von dem er genau weiß, der braucht mich, der wartet
auf mich.”
Anna B. hat viele Ideen. “Ich überlege
immer, was macht man mit der Unruhe, unter der fast alle leiden?” Und
manchmal hilft sie aus ihrem “Privat-Fonds für spezielle Maßnahmen” ein
bisschen nach bei der Beziehungsstiftung.
Wie das alles konkret abläuft, sollten
Sie selbst nachlesen. Es lohnt sich!
Dann erfahren Sie auch, warum Anna B.
einmal mit vier Hunden zu vier verschiedenen Weihnachtsgottesdiensten
ging.
Oder wie sie ihre spätere
Sprechstundenhilfe bei einem besonderen Hausbesuch kennen lernte.
Oder was sie über die Möglichkeiten und
Defizite der Pflegedienste und des Gesundheitssystems zu sagen hat, denn “es
kann nicht richtig sein, dass das ganze System vom Ökonomischen her so
aufgebaut ist, dass die Patienten, je kränker sie sind, umso unattraktiver
für Ärzte werden.”
Anna B. erzählt mitreißend und
gleichzeitig bescheiden – von sich, ihrem Leben und den vielen Menschen, die
sie in ihr Herz geschlossen hat: “Eigentlich ist es ein toller Beruf, so was
wie ein Lebensbegleiter...”
Und Renate Schernus schreibt mit
leichter Hand und erheblicher Sogwirkung.
Deshalb zum Schluss doch noch die
schlechte Nachricht. Sie ist deprimierend und lautet: “Dieses Buch ist beim
Lesen einfach viel zu schnell zu Ende...”
Hartwig Hansen, Dipl. Psych., Paar-
und Familientherapeut, freier Mitarbeiter
beim Paranusverlag Psychosoziale Umschau
1/03
|
|


|
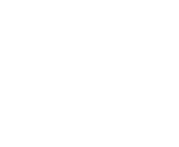 |
|
Rezension von Thomas Feld
Humaner Umgang
„Ein kleines Buch… eine Art Arztroman“– Renate Schernus
erzählt von der Praxis einer befreundeten Ärztin, Anna B. Sie hat ihre
Praxis auf dem Kiez in Berlin. Ihre Patienten sind Menschen wie in jeder
anderen Hausarztpraxis auch. Darüber hinaus kommen Drogenabhängige,
Zuhälter, Prostituierte, psychisch kranke und Menschen aus vielen
verschiedenen Ländern. Hier tauchen, so Renate Schernus, „selbstverständlich
und unentdeckt viele der Menschen (auf), um deren Versorgung andernorts –
auch in der psychiatrischen Szene – sehr viel Krach geschlagen wird.“ (S.7)
Renate Schernus ist selbst Teil der psychiatrischen Szene, hat als
Psychologin eine Klinik und später den Fachbereich Psychiatrie der
Teilanstalt Bethel geleitet. An Anna B. fasziniert sie die besondere
Grundhaltung, mit der sie ihren Patienten begegnet. Anna B. ist neugierig,
immer bereit, von ihren Patienten zu lernen, sich von ihnen in ihren
therapeutischen Interventionen leiten zu lassen und: sie bewahrt sehr
konsequent ihren ärztlichen Standpunkt, enthält sich sozialer oder
kultureller Bewertungen, vermeidet es, den Lebensstil ihrer Patienten an
einer irgend gesetzten Normalität zu messen. Jedem, der kommt gehört ihre
ungeteilte Aufmerksamkeit. Das schließt ihr das Herz ihrer Patienten auf und
verleitet sie immer wieder zu Interventionen, die das übliche
Handlungsschema einer Hausärztin zu sprengen scheinen: dem Mann, der
mehrfach zu ihr kommt und ohne, dass sich eine Diagnose stellen ließe, über
einen kalten Unterleib klagt, kauft sie eine Polar-Unterhose; für die
Kinder, die in ihrem Viertel ohne Gelegenheit zu sinnvoller
Freizeitgestaltung aufwachsen, gründet sie einen Fußballverein; für die
Methadon-Patienten, die zur Substitution in ihre Praxis kommen, erfindet sie
sinnvolle Jobs, die sie aus einem Fonds bezahlt, der sich aus einem Teil
ihres eigenen Einkommens speist.
Von dieser sehr besonderen Art, Ärztin zu sein, erzählt Renate Schernus in
charmanter, humorvoller Weise mit einem Wortwitz, der davon lebt, dass die
beteiligten Personen selbst immer wieder zu Wort kommen. Die Faszination,
die von Anna B. ausgeht, teilt sich auf diese Weise dem Leser mit. Eine
spannende, kurzweilige Lektüre – mit Anregungen über die Lesefreude hinaus?
Einige der unorthodoxen Rezepte der Anna B. regen direkt zur Nachahmung an,
wie die Erfindung des „Situationshelfers“. Doch das Buch ist darüber hinaus
anregend: Immer wieder einmal habe ich mich bei der Lektüre an meinen
eigenen Hausarzt erinnert. Auch bei ihm treffe ich im Wartezimmer Menschen,
die mir sonst als Psychiatriepatienten begegnen. Auch bei ihm nehme ich ein
Engagement wahr, das sich wenig um reguläre Arbeitszeiten schert. Und auch
bei ihm finde ich etwas von der ärztlichen Grundhaltung der Anna B. Zufall?
Vielleicht. Vielleicht aber ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass sich
in den Praxen mancher Hausärzte, bei denen ja nach wie vor die medizinische
Basisversorgung liegt, eine Form humanen Umgangs findet, der einer
spezialisierten Professionalität nicht – mehr? – möglich ist. Wenn das so
wäre, hätte das möglicherweise weitreichende Konsequenzen. Für die ärztliche
Ethik z.B., die sich weniger mit Ausnahmesituationen als mit einer
verantwortbaren Grundhaltung beschäftigen müsste; für die gegenwärtige
Qualitätssicherungsdiskussion, die sich Behandlungsqualität weniger von
originellen, den individuellen Erfordernissen angepassten Einfällen erhofft,
als von einer Standardisierung ärztlichen Handelns. Konsequenzen schließlich
auch für ein Abrechnungssystem ärztlicher Leistungen, in dem sich die
Versorgung chronisch kranker Menschen immer schlechter unterbringen lässt.
Solche Konsequenzen werden durch Renate Schernus nur angedeutet und stören
nicht den novellistischen Charakter des Buches, der sich seiner Autorin verdankt
und sich an Leser wendet, die des „wissenschaftlichen Tons bisweilen
überdrüssig“ sind.
Pfr. Thomas Feld, Sozialpädagoge, MA,
Gütersloh
Deutsches Ärzteblatt / Jg. 100 / Heft 11 / 14. März 2003 |
|


|
|
Rezension von Dr. Gunther Kruse
Obwohl Frau Schernus u.a. mit mir zusammen im Impressum der
„Sozialpsychiatrischen Informationen“ steht, will ich als Rezensent das Wort
ergreifen, denn wo käme man hin, wenn Bekanntschaft oder Freundschaft
Rezensionen unmöglich machen würden. Also gut: Ich bin voreingenommen in
mehrfacher Hinsicht! Zu erahnen, wie umfassend und wie vielfältig meine
Befangenheit gegenüber Frau Schernus ist, will ich den Lesern dieser
Rezension überlassen, genau genommen ist es aber gar keine, denn die Tonhöhe
und Lautstärke, die ich zum erforderlichen Lobgesang benötigte, steht mir in
meinen schriftlichen Äußerungsmöglichkeiten leider nicht zur Verfügung.
Das Buch hat in vielerlei Hinsicht Besonderes zu bieten. Es geht schon mit
seiner Entstehungsgeschichte los. Am Anfang war hier nämlich nicht das Wort,
sondern ein Missverständnis. Tatsächlich hatte Renate Schernus den Auftrag,
ein Buch darüber zu verfassen, wie Hausärzte von den ach so weisen
Psychiatern lernen könnten, den Patienten auch ein wenig psychotherapeutisch
entgegenzutreten. Bezeichnender Weise hatte sie jedoch verstanden, ein Buch
darüber schreiben zu sollen, wie denn Hausärzte ihr bereits vorhandenes
Wissen, an Psychiater weiter vermitteln könnten. So verdanken wir ihrer
zeitweisen „mentalen Weggetretenheit“ bei der Buchplanung dieses kurze und
umso intensivere Portrait einer Ärztin, einer Freundin von ihr, im Kiez
Berlins.
Die Hektik, Intensität, Mehrgleisigkeit, Unkonventionalität, Brisanz,
Menschlichkeit, Ausgepowertheit dieser mustergültigen Hausärztin, die man
zur Honorarpsychiaterin erklären müsste, wird von R. Schernus sprachlich und
inhaltlich sehr gut lanciert, so dass man selber beim Lesen in eine gewisse
hechelnde Hektik verfällt, gleichzeitig sich darüber wundert, teilweise
sogar froh ist, breitgesäßig im öffentlichen Dienst eine Leitungsfunktion
ausfüllen zu dürfen, dabei aber nicht im Ansatz das für die einzelnen
Menschen, in der Klinik oder Ambulanz erreichen könnend, wie diese einfache
Hausärztin es offenbar grandios bewerkstelligt.
Herrlich sind die vielen Beispiele unkonventioneller Hilfestellung zu lesen,
teils lustig, teils erschütternd die geschilderten Patientenschicksale,
immer mit einem feinen Gespür noch für das Komische im Tragischen.
Auch die Praxisstruktur sowohl von den Zimmern, der Toilette, vom Mobiliar,
als auch insbesondere den Mitarbeitern (teils ehemalige Drogenabhängige)
sprechen Bände und werfen gleichzeitig die Frage auf, wie es möglich sein
kann, heutzutage, wo alles nach Normen und DINen zu behandeln ist und
benchmarking schon für eine Krankenpflegehelferin kein Fremdwort mehr ist,
wie sich also ein solches Fossil an humanitärer Ärztlichkeit überhaupt am
Leben halten kann. Wenn Frau Doktor nicht einen Mann hätte, der sich mit
ihrem Berufsdasein arrangiert hat, vielleicht sogar ein wenig stolz auf
seine mit fliegenden Rockschößen stets auf Achse befindliche Frau wäre, dann
hätte Anna B. sicher noch ein Problem mehr.
Andererseits scheint diese, sich von mehreren Seiten zugleich aufzehrende
Berufsgestaltung genussvoller und lebenserfüllender zu sein, als manch
anderes Dahinsiechen im Berufsalltag, bei dem man nicht in Erinnerung hat,
was man in den vergangenen Wochen getan hat, nicht etwa, weil man so viel
Verschiedenes, sondern praktisch Nichts oder nur Dasselbe vollbracht hat.
Wie auch immer, Frau Schernus ist es gelungen (wieder einmal), ein Buch zu
verfassen, was man gerne durchliest, ohne dass man jeden dritten Satz wegen
seiner Wichtigkeit unterstreichen müsste, gleichzeitig aber das gesamte Buch
wegen seiner Botschaft und des rasanten Zupapiergebrachtseins aufsaugt.
Dr. Gunther Kruse, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Hannover
Sozialpsychiatrische Informationen 1/03
|
|


|
|

Illustrationen aus: "Ist Kunst
verrückt?" von Stefan Mitzlaff,
Brückenschlag, Zeitschrift für
Sozialpsychiatrie Literatur Kunst,
1995 Band 11, S. 155- 163
|
|
![]()
![]()