|
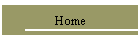
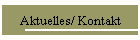
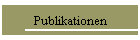
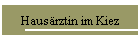
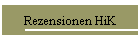
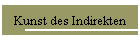
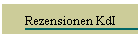
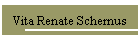


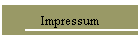
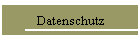
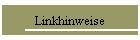
| |
|
Renate Schernus, Die Kunst des Indirekten
Plädoyer gegen den Machbarkeitswahn in Psychiatrie und Gesellschaft
Rezensionen von:
 Michaela Hoffmann Michaela Hoffmann
 Thomas Feld Thomas Feld
 Cornelia Schäfer Cornelia Schäfer |
|
Rezension von Michaela Hoffmann
Umwege –
eigene Wege
Um es vorweg zu sagen: Dies ist ein politisches Buch.
Der kleine Paranus-Verlag der Brücke Neumünster hat sich schon in der
Vergangenheit das Verdienst erworben, in sein kritisches Verlagsprogramm
auch Titel aufzunehmen, die sich mit der zunehmenden Ökonomisierung der
Gesellschaft und ihren Folgen auseinander setzen (Meyer u.a., Hg.: Der
Mensch ist kein Ding!, 1996; Blume u.a., Hg.: Ökonomie ohne Menschen – Zur
Verteidigung des Sozialen, 1997;). In Zeiten, wo – wie mir scheint – kleine
Verlage (auch im psychosozialen Bereich) zunehmend den Vermarktungsschancen
ihrer Titel Priorität einräumen, denn auf ambitionierte und kritische
Inhalte zu setzen und auch die psychiatrische Arbeit mehr und mehr von
Kosten- und Effizienzdenken geprägt wird, sind mir Bücher zu o.a. Thematik
besonders wichtig. Der vorliegende Aufsatzband ist ein Beispiel dafür.
Die Autorin Renate Schernus, Diplompsychologin, und Ende September 2000 nach
über 30-jähriger Tätigkeit in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel aus
dem aktiven Berufsleben ausgeschieden, hat in zahlreichen Vorträgen
vielerorts und auch auf DGSP-Tagungen immer wieder ihre kritische Stimme
erhoben, unbequeme Fragen gestellt und noch unbequemere Antworten gegeben.
Als Redaktionsmitglied der „Sozialpsychiatrischen Informationen“ trägt sie
seit vielen Jahren entscheidend zum Profil der Zeitschrift bei. Mit dem
vorliegenden Band liegt nun zum ersten Mal eine Sammlung ihrer
„Streitschriften“ vor.
Anregend und bereichernd, dazu spannend und mit subtilem Sprachwitz
geschrieben, hat mich die Lektüre des Buches „Die Kunst des Indirekten“ von
Renate Schernus von Anfang an gefesselt.
In zehn Beiträgen behandelt die Autorin aktuelle philosophische und
psychiatrisch-therapeutische Fragen und stellt sie in einen
gesellschaftspolitischen Kontext.
Eines ihrer Hauptthemen ist die Frage nach der Ambivalenz des Fortschritts
und der Macht der Wissenschaft. C.G. Jungs Feststellung von 1931, „dass
jeder Fortschritt im Äußeren auch eine sich stetig steigernde Möglichkeit
einer noch größeren Katastrophe erzeugt“, wird lebendig in ihren
Ausführungen zum Utilitarismus, zur Sterbehilfediskussion und in der
Schilderung „Entgleiste Gesellschaft – ein Anstaltsschicksal zwischen 1933
und 1943“.
Die Autorin warnt vor jeglicher Wissenschaftsgläubigkeit: „Die
›Veränderungsbeschleunigung‹ (O. Marquard) der Moderne nimmt uns den Atem“
und der einzelne Mensch – so Schernus weiter – ist überfordert, die
Gesamtwirklichkeit wahrzunehmen und ist es zunehmend auch in seiner
moralischen Urteilsfähigkeit.
Sie tritt der Huldigung neuer „Denkgötzen“ entgegen, die im Auftrag von
Medizin und Technik den theoretischen Überbau liefern für eine Entwicklung,
in der der Begriff „Ethik“ zweckdienlich angepasst und zurechtgebogen wird.
In all ihren Beiträgen hinterfragt sie eingefahrene Denkmuster und begibt
sich – oft experimentell und spielerisch – auf die Suche nach neuen Wegen,
entwickelt eigene Modelle ethischer Leitbilder.
Besonders gut hat mir ihr Beitrag über die „Kolonisierung des Denkens durch
Veränderung der Sprache“ gefallen. Mit leiser Ironie durchforstet Renate
Schernus die Psychosprache, analysiert, inwieweit beispielsweise
„marktorientierte Worte“ oder „Worte mit Atomisierungstendenz“ Eingang
gefunden haben in die Psychiatrie, und legt überzeugend dar, warum der
psychisch erkrankte Mensch eben kein „Kunde“ ist, auch wenn eine nach
Effizienz und Modernität strebende Psychiatrie ihn so sehen möchte.
Wohltuend auch, dass hier jemand unerschrocken darangeht, dem „Fortschritt“
in der Psychiatrie auf den Zahn zu fühlen und die aktuellen
Qualitätssicherungsdebatten, die verfeinerten Kontrollinstrumentarien und
Zeitmodulrechnungen in der Psychiatrielandschaft kritisch zu hinterfragen.
Wer tut hier was zu wessen Nutzen? Hängen wir Effektivitätsdogmen an, die
unseren Blick für die Wirklichkeit trüben? Laufen wir nicht Gefahr, uns und
unsere Mit-Menschlichkeit zu verlieren in hoch technisierten Arbeitsabläufen
und künstlicher Sprache?
Achtung! Diese Lektüre erzeugt Nebenwirkungen, vermittelt, dass es Sinn
macht, zu zweifeln, weckt konzentrierte Nachdenklichkeit, Mut zum
Aufbegehren – und das alles gelingt der Autorin wohl auch deshalb so gut,
weil uns niemals der erhobene Zeigefinger droht.
Denn Renate Schernus befragt immer wieder auch sich selbst, ringt um
Antworten, bejaht Unvollkommenheit und ist sich der Grenzen der eigenen
Profession, des eigenen Handelns bewusst.
Hier wird jeder Absolutheitsanspruch verworfen, Berechenbarkeit und
Perfektion misstraut. Stattdessen fordert sie den „Mut zur präzisen
Undeutlichkeit“, und diese „erwächst aus zwischenmenschlicher Beziehung,
Kontemplation, Meditation, Poesie und religiöser Erfahrung“.
Was die Autorin damit meint und dass die von ihr beschriebene „Kunst des
Indirekten“ in der Begegnung mit psychisch erkrankten Menschen lebendig
werden kann, lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen bei der Lektüre der
vier Aufsätze, in denen sie ihre Arbeit als Therapeutin schildert. Ob sie
z.B. in „Vorsicht Wahnverdacht“ ihre Erfahrungen in der Psychotherapie mit
psychoseerfahrenen Menschen beschreibt oder sich in „Verschwiegenes im
Fremden“ zur religiösen Thematik im Psychoseerleben äußert – immer spiegelt
ihre Sprache eine enge Verbundenheit mit psychisch erkrankten Menschen und
einen großen Respekt vor ihrem „Anderssein“ sowie – und das macht die
Lektüre immer wieder vergnüglich – eine von hintergründigem Humor getragene
kritische Selbstwahrnehmung.
Am Ende des Buches angelangt, blättere ich noch einmal zurück zu einem
Kapitel mit der Überschrift: „Schuld und Freiheit – Zur Bedeutung von
Schuldzuschreibungen in der Psychiatrie“.
Hier wird deutlich: Immer waren die in der Psychiatrie agierenden „Helfer“
auch Kinder ihrer Zeit. Und die meisten waren wohl überzeugt, das jeweils
„Richtige“ zu tun. Psychiatrie bedeutete und bedeutet immer auch
Schuldzuweisung und Gewaltanwendung. Die Schuldigen wechseln, die Gewalt
ändert ihr Gesicht. Auch heute sind wir überzeugt, das ›Beste‹ zu tun. Und
mir bleibt die Frage: Was wird man in 50 Jahren über eine Psychiatrie sagen,
die uns heute fortschrittlich erscheint?
Michaela Hoffmann / Köln
Soziale Psychiatrie 3/2000 |
|


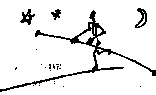 |
|
Rezension von Thomas Feld
Was ist das für eine Kunst, die Kunst des Indirekten? Die Aufsätze, die
Renate Schernus unter diesem Titel herausgibt, kreisen um Glück, Sinn,
Begrenztheit, Schuld, um Gott, um Lebenswege, gewundene und krumme und um
vergessene Tugenden wie Aufmerksamkeit und Geduld. Die Kunst des Indirekten
– sie ist Lebenskunst und somit Ethik im besten Sinne. Dass sich auf Glück
nicht geradewegs abzielen lässt, dass sich der Sinn eines Lebens eher
nebenher einstellt, dass Umwege oft verlässlicher zum Ziel führen als gerade
Wege, und dass das Überhörte, abseits Liegende, an dem man leicht
vorbeigeht, oftmals wichtiger ist als das angepeilte Ziel – solche
Einsichten liegen der Kunst des Indirekten zugrunde. Vielleicht sind das -
wie alle überzeugenden Gedanken? - einfache, schlichte Einsichten. Ungeheuer
spannend jedoch ist, wie Renate Schernus sie in gegenwärtige ethische und
psychiatriepolitische Debatten einbringt. So ist Die Ermordung eines
Prinzips – einige Gedanken zum Utilitarismus am Beispiel des Raskolnikoff
einer der besten Beiträge zur Debatte um Bio-Ethik und Utilitarismus die ich
gelesen habe. So verrät Verschwiegenes im Fremden – zur religiösen Thematik
im Psychoseerleben noch bevor das Thema Religion und psychische Erkrankung
seinen gegenwärtigen Boom erlebte etwas von der Neugier und dem Mut der
Autorin, sich auch abseits liegender, tabuisierter Themen anzunehmen. Und so
spiegelt der Beitrag Abschied von der Kunst des Indirekten? – Umwege werden
nicht bezahlt den verhaltenen Zorn der Autorin angesichts der Mythen von
Unternehmenskultur, Marktpolitik und Qualitätssicherung, die gegenwärtig den
sozialen Bereich überfluten. Alle in diesem Band versammelten Aufsätze
zeichnet aus: ihr Stil ist klar, deutlich, gut zu lesen. Man spürt das Feuer
im Bauch, mit dem die Autorin in brisante Debatten eingreift, sowie die
Neugier, die Freude und den Humor mit denen sie der Buntheit menschlichen
Lebens begegnet. Dass diese Buntheit und Fülle, ja das Leben der Menschen
selbst bedroht ist, wo Menschen in direktem Zugriff und geradewegs auf noch
so erstrebenswerte ethische, gesundheitspolitische, therapeutische Ziele
zugehen, lässt sich in diesem Buch lernen. Ich wünsche ihm viele Leserinnen
und Leser.
Pfr. Thomas Feld, Sozialpädagoge MA
Gütersloh
|
|


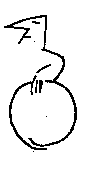 |
|
Rezension von Cornelia Schäfer
Es ist heutzutage wohl tatsächlich eine Kunst, gegen die ehrgeizigen Pläne
der mit Forschungsmitteln verwöhnten Bio- und Medizinwissenschaften
anzutreten. Allzu verführerisch erscheint vielen ihre Vision eines
entschlüsselten Menschen, der dank gentechnischer Erkenntnisse künftig nicht
mehr leiden müssen soll. Allzu stark auch die Allianz aus karrierebewussten
Wissenschaftlern, wendigen Ethikern und finanzkräftigen Konzernen, der die
Psychologin Renate Schernus nun allerdings einen “Machbarkeitswahn”
attestiert. Natürlich sei es wissenschaftlich legitim, nach dem stofflichen
Korrelat der milliarden- und abermilliardenfachen Erscheinungsformen der
lebendigen Natur zu suchen, räumt sie ein. Zu einem fatalen Irrweg werde das
erst dann, wenn das Vorgefundene als ausreichende Erklärung für komplexe
biologische und psychosoziale Erscheinungen angesehen werde. Denn dieser
naturwissenschaftliche Blick reduziere den Menschen auf eine sechs Fuß lange
Aneinanderreihung verschiedenster Atome, verleite zu der Illusion, man könne
hier zum Guten eingreifen oder zumindest doch Schlechtes aussondern und
öffne letztlich Euthanasiebefürwortern wie dem sogenannten Bioethiker Peter
Singer Tür und Tor.
So weit, so bekannt. Was das Buch von Renate Schernus über ihre zutreffende
Analyse hinaus unbedingt lesenswert macht, ist die Art, wie sie in der
Auseinandersetzung mit den Menschheitsbeglückern aus den Forschungslabors
zugleich sehr eindringlich den Raum für ein anderes Denken öffnet. Wem würde
es beispielsweise einfallen, eine Krankheit mit dem Begriff "glücken" zu
verbinden? Die Psychologin, die lange Jahre leitend in der Psychiatrie in
Biefeld-Bethel tätig war, tut es. Sie beschreibt einen Mann, dem in höchster
persönlicher Not eine Psychose “glückte”, was ihm endlich die Hilfe
zugänglich machte, die er vorher vergeblich gesucht hatte. Ihre Schilderung
macht deutlich, dass Krankheit eine sogar kreative Strategie der Seele sein
kann, um ein heikles Problem verschlüsselt zu benennen, um sich vor etwas
noch Bedrohlicherem zu schützen oder auch nur auf die eigene Not aufmerksam
zu machen. Ihr Respekt vor solchen, andere oft befremdene Umwege der Seele
kommt auch zum Ausdruck, wenn sie die Schicksale von Langzeitpatienten
schildert, die sie jahrelang bei der Suche nach dem eigenen Weg begleitet
hat. Sie erlebte, wie lange ein Mensch stagnieren kann, bevor er sich
bewegt, wie eine Suche jahrelang scheinbar nur in die Irre führen kann und
dabei nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Dafür, dass solch eine
Langsamkeit möglich und der dafür nötige Raum und Respekt erhalten bleiben,
setzt sich Renate Schernus nachdrücklich ein. Auch im Interesse der
sogenannten Gesunden, die diese Opposition gegen die unausweichlichen Zwänge
der Zeit für die eigene Seelenhygiene bräuchten.
“Die Technik ist auf dem Wege, eine solche Perfektion zu erreichen, dass der
Mensch bald ohne sich selbst auskommt”, zitiert sie den polnischen
Schriftsteller Stanislaw Jercy Lec. Dass zu dem so verstandenen Menschsein
auch sinnlos erscheinendes Leid gehört, versucht die Psychologin nicht zu
beschönigen. Aber dass man eben nicht "ohne sich selbst" auskommt, das macht
sie auf zugleich scharfsinnige und berührende Weise klar.
Cornelia Schäfer am 15.2.01 – WDR 3 “Am Abend vorgelesen” |
|


Illustrationen
aus: "Ist Kunst verrückt?"
von Stefan Mitzlaff
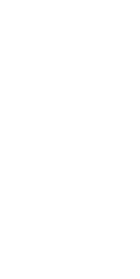 Brückenschlag, Zeitschrift für Sozialpsychiatrie Literatur Kunst
Brückenschlag, Zeitschrift für Sozialpsychiatrie Literatur Kunst
1995, Band 11, S.
155- 163 |
|
![]()
![]()